Rechte Diskursverschieber als „Freiwild woker Studierender“?
Mimi Weggrund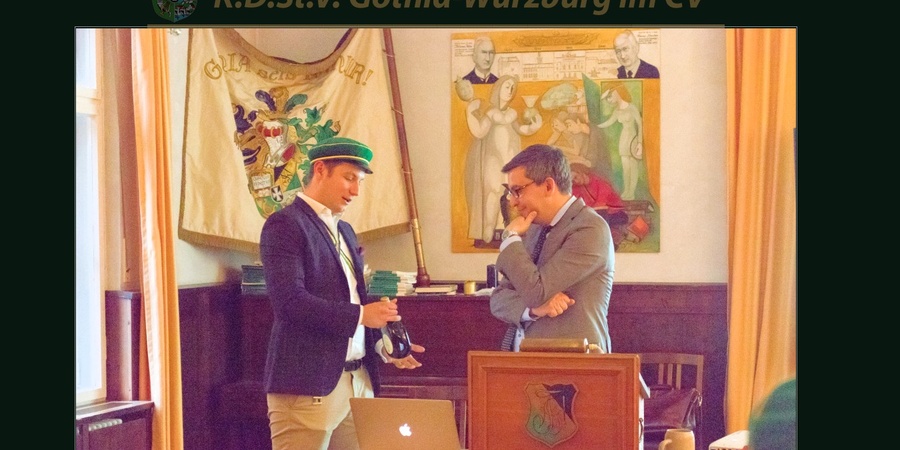
„Ein Frieden, der kein Frieden war: 100 Jahre Versailler Vertrag“ – Vortrag von Prof. Dr. Peter Hoeres.
Am 1. Mai 2025 verkündete die rechte Publikation „Preußische Allgemeine“ einen „Sieg über die Cancel Culture“ und feierte damit den Würzburger Historiker Peter Hoeres, der laut der Zeitung „ein Signal dafür [gesetzt habe], dass konservative Akademiker an Hochschulen kein Freiwild sind.“ Schon einige Wochen zuvor hatte die rechtskatholische „Tagespost“ über die Vorgänge rund um den Lehrstuhl für Neueste Geschichte an der Universität Würzburg berichtet und Hoeres‘ Agieren als Möglichkeit präsentiert, „wie man Woken das Handwerk legt“. Ähnlich positive Kommentare waren auch in anderen konservativen und rechten Blättern zu lesen: Der vermeintlich bemerkenswerte Erfolg von Peter Hoeres über vorgeblich linke Aktivist*innen wurde beispielsweise in der „Junge Freiheit“, in der „Welt“, im „Cicero“ und in „Tichys Einblick“ ausgiebig gewürdigt.
Der Jubel, der im rechten Lager über den verkündeten Sieg ausbrach, war damit ähnlich groß wie die Empörung, die einige Wochen zuvor unter Konservativen entbrannt war, als die Vorgänge ins Rollen gekommen waren. Doch was genau ist in der fränkischen Provinz vorgefallen, das rechte und konservative Gemüter in dieser Form erhitzen konnte?
Seinen Anfang nahm alles in einer Sitzung des Studierendenparlaments an der Universität Würzburg: Dieses beschloss am 12. März einen Antrag, der unter dem Titel „Gegen neurechte Diskursverschiebung in der Lehre“ mehrere Forderungen enthielt. Mehrheitlich bezogen sich diese auf den Lehrstuhl für Neueste Geschichte, an dem Strukturen der „Neuen Rechten“ sowie Kontakte in offen ultra-rechte Kreise identifiziert wurden. Als Konsequenz wurde einerseits eine Ausweitung und Diversifizierung des Lehrangebots für notwendig erachtet, andererseits wurde der Lehrstuhlmitarbeiter Benjamin Hasselhorn aufgefordert, eine eidesstattliche Erklärung abzugeben, nicht unter Pseudonym in der extrem rechten Zeitschrift „Sezession“ veröffentlicht zu haben.
Kurz darauf reagierte die lokale und regionale Presse. Am 19. März berichteten so die „Würzburger Mainpost“ und der BR über die Vorgänge. Peter Hoeres gab sich angesichts der Vorwürfe, er fördere eine neurechte Diskursverschiebung, schockiert. Diese Einschätzung überrascht, wenn man seine medialen Einwürfe und Aktivitäten in der Vergangenheit betrachtet. Denn gerade die FAZ, NZZ und Cicero boten und bieten ihm immer wieder Raum, seine Ansichten breitenwirksam vorzutragen und sich als Historiker am rechten Rand des konservativen Spektrums zu profilieren. Dabei grenzt er sich bewusst von allen Positionen links von ihm und damit von der breiten Mehrheit seiner Kolleg*innen ab, denen er zugleich unterstellt, in Forschung und Lehre einer „linksgrünen Ideologie” zu folgen. So trat er im Juni 2024 mit großem Tamtam aus dem „Verband der Historikerinnen und Historiker“ aus, dem er „ideologische Verblendung und Antisemitismus” vorwarf; im März 2025 bezeichnete er die „Bundeszentrale für politische Bildung“ als „linksgrüne Vorfeldorganisation“, nachdem es ihm nach acht Jahren Mitarbeit nach eigener Aussage nicht gelungen war, eine Öffnung für rechte und konservative Positionen zu erreichen. Stattdessen würden weiterhin „radikale Kampfschriften“ verlegt, „Linksaußen-Einrichtungen wie die Amadeu Antonio Stiftung“ unterstützt und wichtige Positionen mit identitätspolitischen Aktivist*innen besetzt.
Diese offene Diskursverschiebung nach rechts verfolgt Peter Hoeres aber eben nicht nur in der medialen Außendarstellung, sondern auch an seinem Lehrstuhl. So widmet er sich dem bei konservativen Historiker*innen beliebten Thema des „Diktaturenvergleichs“ und hat als Mitarbeiter hierfür Hubertus Knabe nach Würzburg geholt, der seinerseits 2018 wegen massiver Versäumnisse bei der Schutz- und Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeiter*innen als Direktor der "Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen" abberufen worden war. Hintergrund dieser Entscheidung war, dass Knabe jahrelang das übergriffige Verhalten seines Stellvertreters gegenüber weiblichen Beschäftigten nicht unterbunden, sondern diesen aktiv in Schutz genommen und so die Mitarbeiterinnen allein gelassen hatte.
Nach dem Beschluss des Bayerischen Staatsministeriums zur geschlechtergerechten Sprache im April 2024 wies Hoeres als Geschäftsführender Vorstand des „Instituts für Geschichte“ in einer Rundmail an alle Geschichtsstudierenden eigenmächtig und wahrheitswidrig darauf hin, „dass Sparschreibungen und Sonderzeichen zur Geschlechterumschreibung bei Hochschulprüfungen unzulässig“ seien. Er ignorierte dabei, dass sich die Anordnung aus München nur auf Verwaltungsakte bezog und eben gerade nicht in die Wissenschafts- und Lehrfreiheit der Universitätsangehörigen – inklusive Studierender – eingriff.
Zudem zeigt sich die Offenheit von Hoeres gegenüber rechten Positionen auch darin, dass er im Jahr 2019 Benjamin Hasselhorn als Mitarbeiter einstellte. Dieser hatte zuvor bei der „Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt“ gearbeitet und war seit dem Jahr 2017 immer wieder mit Kritik an einer vermeintlich „weichgespülten“ Kirche in der Öffentlichkeit aufgetreten. Statt eine Politisierung zuzulassen, solle sich die Kirche nach Ansicht Hasselhorns wieder „auf Christus” besinnen, um die Gläubigen zurückzugewinnen. Zu diesem Zeitpunkt war Hasselhorn, wie inzwischen bekannt ist, zudem Mitglied der AfD.
Es ist dieser Benjamin Hasselhorn, der im Beschluss des Studierendenparlaments ebenfalls eine Rolle spielt. Die Debatten um ihn begannen allerdings – auch außerhalb Würzburgs – schon deutlich früher, nämlich als Hasselhorn, der 2019 von der AfD in die CSU gewechselt war, 2020 überraschend zum neuen Sachverständigen der Unionsfraktion im Hollenzollernstreit (vgl. AIB Nr. 39) berufen wurde. Nach seinem Auftritt im Kulturausschuss des Bundestages äußerten einige Historiker*innen, unter ihnen die damalige Vorsitzende des „Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands“, Zweifel an seiner Expertise und verwiesen auf seine Nähe zu den Hohenzollern, deren Bedeutung im NS er in seinem Gutachten vernebelte. Schon damals stellte sich eine Gruppe von zehn Historikern hinter Hasselhorn und warf dem Verband und seiner Vorsitzenden vor, eine offene Debatte zu verhindern und einen „seriösen Nachwuchshistoriker“ zu diffamieren. Dass das mit der Seriosität durchaus angezweifelt werden kann, deckte kurz darauf der Historiker Niklas Weber auf. In mehreren Artikeln, die zwischen 2020 und 2021 in der SZ, der taz und im Merkur veröffentlicht wurden, konnte er Verflechtungen Hasselhorns in (extrem) rechte Kreise aufdecken. Eine enge Beziehung besteht zu Karlheinz Weißmann, der in Northeim Hasselhorns Geschichtslehrer gewesen war und dessen extrem rechtes Weltbild vor kurzen noch einmal in der FAZ offengelegt wurde. Doch pflegte Hasselhorn nicht nur Kontakt zum ultra-rechten „Institut für Staatspolitik“ (IfS) um Weißmann und Götz Kubischek. Weitere Verbindungen zur neurechten Szene weisen neben den Artikeln von Niklas Weber auch Recherchen der „Autonomen Antifa Freiburg“ nach, die sich insbesondere mit Hasselhorns Doktorvater Hans-Christoph Kraus in Passau beschäftigen. Darüber hinaus konnte Niklas Weber in seinen Beiträgen aufzeigen, dass Hasselhorn selbst unter Pseudonymen in äußerst rechten Organen wie der „Blauen Narzisse“ und der „Sezession“ publiziert hat. Wie stark Hasselhorns Artikel von rechten Gedanken durchzogen sind, die sich auch in seiner Forschung spiegeln, verdeutlichte Weber in der FAZ am 30. April. In einem Artikel im „Der Spiegel“ vom 9. Mai war schließlich sogar von sechs Pseudonymen die Rede, welche Hasselhorn allein in der „Sezession“ für mehr als 60 Artikel bis 2019 nutzte.
Vor dem Hintergrund der geschilderten Vorgänge am "Lehrstuhl für Neueste Geschichte" erscheint der Beschluss des Studierendenparlaments vom 12. März nicht nur legitim, er ist sogar noch zurückhaltend formuliert. Umso schlimmer ist es, dass die Studierenden mit ihrem Anliegen keinerlei Erfolg hatten. Peter Hoeres ist es vielmehr gelungen, den Diskurs in seinem Sinne zu prägen: Aus Studierenden wurden einzelne politische Aktivist*innen, die teilweise außerhalb der Universität zu verorten seien und ihn durch die Forderung eines zusätzlichen Lehrangebots in seiner Lehrfreiheit einschränkten. Dabei warf er zynischerweise seinerseits den Studierenden vor, „den Pluralismus nicht auszuhalten“ und zudem grundlos die Karriere eines „aussichtsreichen Nachwuchswissenschaftlers“ zerstören zu wollen.
Bei seinen Aktivitäten wurde er auch vom „Netzwerk Wissenschaftsfreiheit“ unterstützt, aus dessen Mitte ein Solidaritätsaufruf gestartet wurde, den fast 700 Personen unterschrieben. Dass sich auf der Liste jedoch nur wenige Neuzeithistoriker*innen finden und auch die aktiven Professor*innen sowie die Mehrheit der Kolleg*innen aus dem „Institut für Geschichte“ in Würzburg auf eine Unterschrift verzichteten, sollte den Studierenden Mut machen, weiterzumachen.